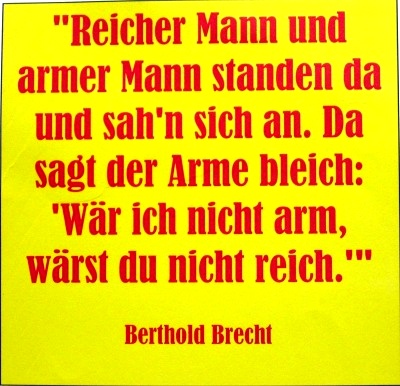Über den Rätekommunismus, der vor längerer Zeit eine Rolle in der Arbeiterbewegung spielte, wird wieder diskutiert, nachdem zuletzt die 68er-Bewegung eine Wiederbelebung versucht hatte. Auch sind seit Beginn der neuen Militarisierungsphase in Deutschland und Europa einige Schriften publiziert worden, die einen dissidenten Standpunkt aus der Arbeiterbewegung – sei es zum Ersten oder zum beginnenden Dritten Weltkrieg – in Erinnerung rufen.
Der Rätekommunismus, der das Erbe von Marx und Engels gegen Reformismus und Revisionismus bewahren wollte, stößt heute dort auf Interesse, wo es nicht bloß um die Verirrungen des Neoliberalismus, sondern um eine Kritik der kapitalistischen Produktionsweise selbst geht. Er wird weniger als ein politisches Programm propagiert, soll vielmehr Anregungen geben, klassische Fehler der Arbeiterbewegung zu vermeiden.
Unterstützt wird diese Diskussion durch den Verlag Red & Black Books sowie die Website Rätekommunismus. Beide stellen – online und im Printformat – mittlerweile zahlreiche Neueditionen zur Verfügung, z.B. Texte aus der alten „Rätekorrespondenz“. Und dazu wurden auch schon einige Publikationen im Gewerkschaftsforum oder im Untergrund-Blättle vorgestellt (z.B. aus der Pannekoek-Reihe „Die Grundlagen der sozialen Revolution“der Band 2, Das falsche Bewusstsein“, sowie der Band 3, „Der Dritte Weltkrieg“).
Gegen Reformismus und Revisionismus
Vor den Schriften von Pannekoek zu Nationalismus und Militarismus war mit der Wiederveröffentlichung der „Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung“ (2020), die damals die Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) erarbeitet hatte, ein Text zugänglich geworden, der einiges zu der legendären Frage nach der sozialistischen Alternative anzubieten hat. Eine Antwort darauf wird ja bei der Marx‘schen Kapitalismuskritik immer wieder vermisst oder diese Kritik wird gleich für den Weg des Leninismus/Stalinismus in einen „autoritären Staatssozialismus“ haftbar gemacht. Denn kaum kommt man mit einer an Marx orientierten Kritik, schrieb seinerzeit Hermann Lueer, der Herausgeber von Red & Black Books, „kaum hat jemand einige Argumente gegen die Marktwirtschaft vorgebracht, kommt die Frage, ob man denn tatsächlich Planwirtschaft wolle.“ Dass diese ein Unding ist, soll ja seit dem Untergang des Ostblocks felsenfest stehen.
In der akademischen Befassung mit Marx, die es seit dem Ende des realen Sozialismus wieder in einer ernsthafteren, nicht einfach aufs antikommunistische Feindbild setzenden Form gibt und die seit der großen Finanzkrise 2007/08 (sowie dem nachfolgenden Jubiläumsjahr 2018) durch eine kleine Marx-Renaissance Auftrieb erhielt, wird übrigens eine solche Identifizierung der Marx‘schen Sozialkritik mit Stalinismus, Totalitarismus oder Autokratie zurückgewiesen. Allerdings herrscht hier oft – wie sich an den Schriften des Philosophen Michael Quante zeigt – eine philosophische Deutung vor, die die Kapitalismuskritik in geistesgeschichtlicher Perspektive aufnimmt und an den biographisch zweifellos gegebenen Ausgangspunkt des Deutschen Idealismus zurückbindet, also den Werdegang des jungen Linkshegelianers Marx in den Mittelpunkt rückt. Dabei gerät dann die Verbindung des späten Marx zur Arbeiterbewegung aus dem Blickfeld bzw. erscheint das sozialistische Projekt der gesellschaftlichen Umwälzung als ein sozialphilosophisch motiviertes, aber letztlich offenes und nicht zu Ende gedachtes Vorhaben.
Die rätekommunistischen Theoretiker stellen dazu natürlich eine Gegenposition dar. Das Untergrund-Blättle hatte dazu die Schrift über die kommunistischen „Grundprinzipien“ vorgestellt. Die Veröffentlichung war 2020 der Startschuss für eine marxistische Debatte, die sich auf die Frage zuspitzte: „Wie geht Planwirtschaft?“. Es gab im Anschluss daran sowie anknüpfend an kritische Nachfragen zum Thema Arbeitszeitrechnung (Stichwort: „Jeder empfängt, was er gibt“) einen weiteren Diskussionsbeitrag sowie in der Folge immer wieder Hinweise auf Neueditionen aus der rätekommunistischen Strömumg. Zuletzt erschien dazu unter dem Titel „Die Arbeiterbewegung auf dem Weg ins Zeitalter der Weltkriege“ eine ausführliche Würdigung von Pannekoeks Streitschrift „Klassenkampf und Nation“ aus dem Jahr 1912.
Man könnte dieses Pamphlet, hieß es in der Vorstellung der vergessenen Schrift, „als ein Dokument von welthistorischem Rang bezeichnen“. Das aber nicht, weil es eine erschöpfende Analyse zum Thema Nationalismus zu bieten hätte (zur Nationalismuskritik wären eher andere ältere Texte z.B. von Julian Borchardt heranzuziehen), sondern weil es die historische Zeitenwende in Erinnerung ruft, als die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts aus ihrer internationalistischen Programmatik heraus definitiv den Weg zur Nation fand. Das Buch weist somit eine politische Alternative nach, die zwar praktisch bedeutungslos blieb, aber als Denkanstoß für die heutige Zeit wirken könnte, wo ebenfalls wieder der Weg in einen Weltkrieg – unter takräftiger sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Mitwirkung – als unvermeidlich erscheint.
Frank Bernhardt zog dazu das Resümee: „Die Edition der alten Schrift von Pannekoek ist somit keine historische Reminiszenz an eine längst untergegangene Ära der Arbeiterbewegung, sondern von unmittelbarer Brisanz. Denn sie zeigt, dass die Unterordnung der sozialen unter die nationale Frage keine Selbstverständlichkeit ist. Im Gegenteil. Das Aufzeigen des fundamentalen Gegensatzes von sozialen Anliegen und nationalen Programmatiken ist ein Verdienst dieser Veröffentlichung, die angesichts der Unbedingtheit, mit der gegenwärtig das Soziale als eine Fußnote nationaler Durchsetzungsfähigkeit behandelt wird, als wichtige Gegenrede gelesen werden kann.“
Grundlagen der sozialen Revolution
Die rätekommunistische Tradition erscheint heute auch deshalb interessant, weil sie schon früh zu den sozialistischen Parteikontroversen, zu Lenins oder Luxemburgs Imperialismustheorie Stellung nahm oder eine – auf Marx zurückgehende – Kritik an der Entwicklung in Sowjetrussland vorlegte. Dies liefert Material für einen Rückblick auf die Ära des „realen Sozialismus“. Aber es geht nicht nur um die Aufarbeitung historischer Vorgänge. Aktuell spielt die Auseinandersetzung mit Lenins Imperialismustheorie etwa da eine Rolle, wo sich antikapitalistische Positionen in der Friedensbewegung zu Wort melden (siehe zuletzt IVA).
Nachdem vor Jahren die umfangreiche deutsche Edition der Texte begann, die die holländischen Rätekommunisten um Anton Pannekoek vor dem Zweiten Weltkrieg publizierten, liegt nun seit Anfang 2025 die Reihe „Grundlagen der sozialen Revolution“ komplett vor. Band 1 der Reihe, „Die Arbeiterräte“, ist dabei die erste deutsche Übersetzung des Buchs „De arbeitersraden“, das Pannekoek pseudonym 1946 in den Niederlanden veröffentlichte. Es ist – ähnlich wie die wiederveröffentlichten „Grundprinzipien“ – eine Grundlagenschrift der rätekommunistischen Strömung, die sich damals nach den Auseinandersetzungen in der europäischen Sozialdemokratie gebildet hatte, als die Mehrheit ins imperialistische Lager überging und sich mit dem Leninismus eine Gegenposition machtvoll durchsetzte.
Mit dem Sieg der Oktoberrevolution formulierten die Rätekommunisten dann ihre Kritik am Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion, die man vielleicht, mit Pannekoeks Worten, so zusammenfassen könnte: Die KP habe es nicht geschafft, dass „die Produzenten selbst Meister über die Produktionsmittel“ (Band 1, 5) werden. Lueer betont im Vorwort, dass sowohl die Kritik Rosa Luxemburgs wie der Anarchisten sich in einem moralischen Vorwurf an die neue Herrschaft der KPdSU erschöpft und damit das zentrale Problem verfehlt habe – die Frage danach nämlich, welche ökonomischen Veränderungen notwendig sind, wenn die Abschaffung der Lohnarbeit ins Werk gesetzt werden soll. Die „Grundprinzipien“ der GIK machen dies zum Thema und formulieren, ebenfalls kurzgefasst, dass es das Ziel der proletarischen Revolution sei, „eine neue Beziehung zwischen dem Produzenten und dem gesellschaftlichen Produkt herzustellen“ (Band 1, 9). Das Rätesystem, die politische Organisationsform dieser Umwälzung, ist in dem Band der GIK unterstellt, denn er versucht die Grundlinien dieses neuen Produktionsverhältnisses herauszuarbeiten.
Der von Pannekoek später veröffentlichte (in den Kriegsjahren 1941/42 entstandene) Band über die Arbeiterräte liefert jetzt gewissermaßen das Gegenstück zur GIK-Publikation. Im „Mittelpunkt seiner Darstellung stehen die Räte als Kampforganisation und zugleich als Organisation der wirtschaftlichen Umgestaltung“ (Band 1, 10), schreibt Lueer im Vorwort. Beide Veröffentlichungen zusammen bieten also das Programm der damaligen rätekommunistischen Bewegung in Sachen soziale Revolution. In Band 2 „Das falsche Bewusstsein“ geht Pannekoek dann der Frage nach, warum so viele Menschen eine Weltordnung akzeptieren, die gegen ihre Interessen arbeitet. Warum lehnen sie sich nicht auf, sondern verteidigen oft sogar das System, das sie beherrscht? Seine Antwort heißt in Kurzfassung: Die Herrschaft des Kapitals beruht nicht nur auf Zwang, sondern wird von Ideologien begleitet, die das Denken der Menschen prägen.
Militarismus, Kapitalismus und Imperialismus
Pannekoek, der 1960 verstarb, erlebte noch den Beginn des Kalten Kriegs zwischen Ost und West. Der dritte Band „Der Dritte Weltkrieg“ bringt dazu Texte aus den 50er Jahren, greift aber auch auf frühere Veröffentlichungen zurück, die im und nach dem Ersten Weltkrieg zur Kritik des Militarismus erschienen. Sie wenden sich gegen die Vorstellung, Kriege seien – in Politikversagen gründende – Ausnahmeerscheinungen. Vielmehr habe man es hier mit einer notwendigen Konsequenz des kapitalistischen Systems zu tun: Solange Profite das oberste Ziel der Wirtschaft sind, solange Staaten ihre Macht durch die Kontrolle über Rohstoffe, Handelswege und Arbeitskräfte sichern wollen, wird Krieg ein Mittel der Politik bleiben, um diese Interessen durchzusetzen.
Damit sind genau die Fragen angesprochen, die in der oben genannten Auseinandersetzung über antikapitalistische Positionen in der Friedensbewegung eine Rolle spielen und die jetzt etwa bei den Kontroversen um Ole Nymoens Kritik der Lenin‘schen Imperialismustheorie, bei der Debatte mit Trotzkisten oder Marxisten-Leninisten im Vordergrund stehen. Pannekoek schreibt: „Die eigentliche Ursache des Krieges ist der Imperialismus, die Politik, die nach dem Besitz fremder Gebiete und als Mittel dazu nach der Weltmacht strebt. Die ökonomische Entwicklung, die zu diesem Imperialismus geführt hat, ist zugleich die tiefste Ursache des Weltkrieges. Der Imperialismus ist die modernste und entwickelte Form des Kapitalismus. Je mehr Geld aus Gewinnen und Dividenden zu neuem Kapital akkumuliert wird, um es gewinnbringend zu investieren, desto schwieriger wird es, dafür im Innern eine gute Gelegenheit zu finden. Deshalb richten die Kapitaleigner ihren Blick auf ferne, unentwickelte Länder und fremde Kontinente…“ (Band 3, 19)
An dieser Positionsbestimmung fällt als Erstes auf, dass sie sich im Umkreis der Lenin‘schen Imperialismustheorie bewegt. Kriege werden demnach auf Geheiß des Kapitals geführt, denn der Staat ist in der Hand der Bourgeoisie, die im letzten Stadium des Kapitalismus, in der Phase der Fäulnis und Stagnation, nur noch durch Eroberungskriege ihre Profitmaximierung gewährleistet sieht und damit endgültig ihre vorwärts treibende, die Produktivkräfte entwickelnde Rolle verloren hat. Diesen Staat den Händen der Bourgeoisie zu entreißen, ist dann der Auftrag der kommunistischen Partei, denn die bürgerliche „Politik zeigt in ihrer Willfährigkeit gegenüber den Reichen, dass sie gar nicht ‚unabhängig‘ gemacht, sondern ‚hörig‘ betrieben wird und von den Monopolen gesteuert. Die Reichen üben die Macht aus! Lautet der Grund- und Hauptsatz der ‚Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus‘, die in ihren unterschiedlichen Ausführungen immer nur beteuert, daß der Staat ein Werkzeug des Volkes nicht sei, da ihn die andern besetzt haben.“ (Karl Held) Deshalb muss sich die Kommunistische Partei seiner bemächtigen, um ihn dann im Interesse des Proletariats zu benützen.
Lueer hat jüngst eine Rezension zu Lenins Schrift „Staat und Revolution“ veröffentlicht, die weithin als Klassiker der marxistischen Theorie gilt. Darin stellte Lenin eine radikale Vision der proletarischen Befreiung mit Losungen wie „Alle Macht den Räten“ und dem „Absterben des Staates“ vor. Lenin berufe sich „ausführlich auf Marx und Engels, um zu begründen, warum der bürgerliche Staatsapparat zerschlagen werden müsse, um an dessen Stelle auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel und unter der Macht der Arbeiterräte eine zentrale organisatorische Leitung und Verwaltung für Produktion und Distribution zu errichten“. Gegen diese straff organisierte, dem Vorbild einer staatlichen Postverwaltung nachempfundene zentrale Verwaltung, die im Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus angeblich zum „Absterben des Staates“ führt, bringt Lueer die Kritik der GIK in Stellung, die bereits 1927 in ihrem Artikel „Marx-Engels und Lenin: Über die Rolle des Staates in der proletarischen Revolution“ auf den logischen Widerspruch dieser Konzeption hingewiesen hätten.
Das Fazit dieser kritischen Befragung der leninistischen Tradition lautet dann: „Die Verstaatlichung der Produktionsmittel unter Lenin bedeutete nicht die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, sondern ihre Transformation in Staatskapitalismus.“ Und die Rätekommunisten werden als die konsequentesten Gegenspieler dieser Sozialismuskonzeption angeführt. Wie das Beispiel der Imperialismustheorie zeigt, ist in den theoretischen Grundlagen jedoch nicht nur Distanz zum Marxismus-Leninismus, sondern auch Übereinstimmung gegeben – wobei hinzu kommt, dass sich die Rätekommunisten untereinander gar nicht einig waren. Wie es auf der Website Rätekommunismus heißt, waren „verschiedene Einschätzungen und Theorien auch unter Rätekommunisten nicht unumstritten“ und wurden „unterschiedliche Standpunkte zu den Fragen der Strategie und der Taktik des Klassenkampfes verhandelt“.
Mit den Editionen, die jetzt vorliegen, kann man sich ein genaueres Bild dieser vergangenen Kontroversen machen. Natürlich fanden sie unter einer anderen weltpolitischen Konstellation statt – zu einer Zeit, als es eine kämpferische Arbeiterbewegung gab sowie später einen ganzen Block, der sich dem imperialen Machtanspruch des Kapitals widersetzte. Insofern führt der Rückblick in ganz andere politische Gefilde. Doch in diesem ‚historischen Kostüm‘ tauchen einige der Grundfragen auf, mit denen man es bei der Marx‘schen Kritik des Kapitalismus zu tun hat. So ist dieser Umweg, wenn man die Zeit dafür hat, vielleicht doch nicht ganz vergebens für die heutigen Zeitgenossen, die immer noch unter der Herrschaft des Kapitals leben und sich damit nicht abfinden wollen.
———–
Anton Pannekoek, Die Grundlagen der sozialen Revolution, Band 1: Die Arbeiterräte, 2024, 164 S.; Band 2: Das falsche Bewusstsein, 2024, 169 Seiten; Band 3: Der Dritte Weltkrieg, 2025, 121 S. Alle Hamburg, Red & Black Books, Hardcover, jeweils 18 Euro. Die Red & Black Books können über die Website https://redblackbooks.de/ direkt beim Verlag bestellt werden. Weitere Texte und aktuelle Kommentare finden sich auf der Website https://www.raetekommunismus.de/.
Der Beitrag erschien auch auf https://www.i-v-a.net/. Bildbearbeitung: L. N.