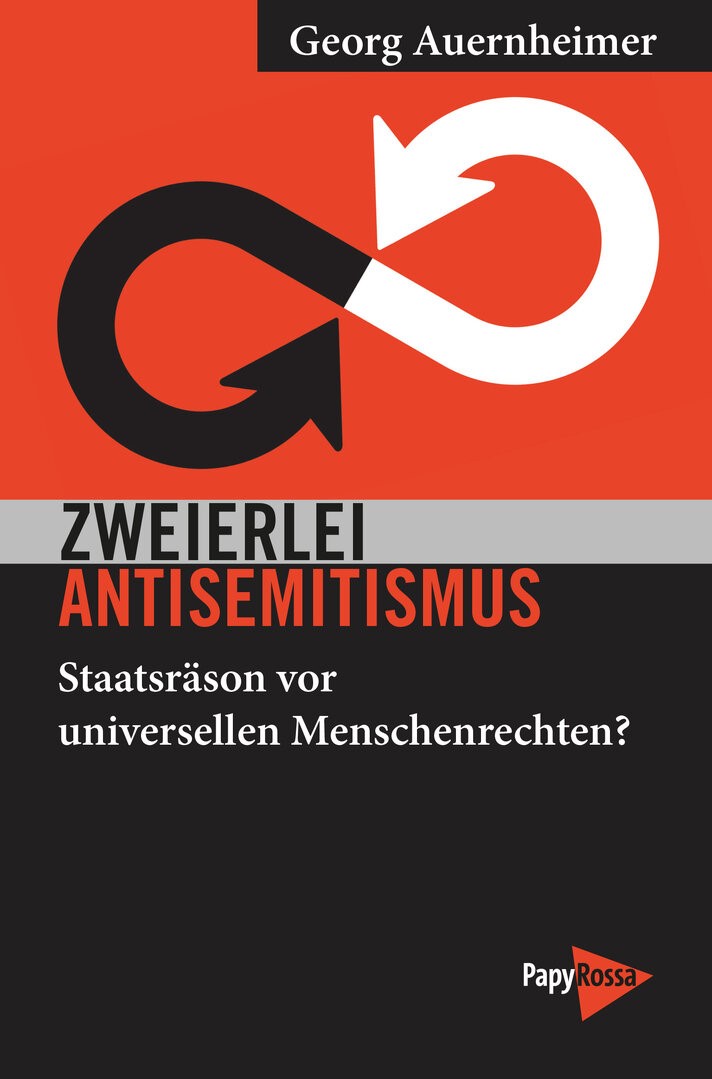„Antisemitismus“ ist in der BRD zum Kampfbegriff des Obrigkeitsstaates geworden, der damit an den verschiedensten Fronten zuschlägt. Dagegen setzen sich die – mittlerweile recht zahlreichen – Demonstranten zur Wehr, zunehmend aber auch auch Experten.
Das kann z.B. heutzutage einem antimilitaristisch gesinnten Gewerkschafter mitten in Deutschland passieren: Er „kritisiert die Lieferung von Rüstungsgütern an Israel und wird daraufhin fristlos entlassen“, wie Jacobin am 30. September über den Auftritt eines jungen Mannes bei einer Antikriegsveranstaltung berichtete. Der Fall hat aber auch eine kleine erfreuliche Seite, denn es gab breite Unterstützung für den betroffenen DHL-Mitarbeiter Christopher T., der bislang am Flughafen Halle Leipzig arbeitete und dabei buchstäblich hautnah mit deutschem Rüstungsexport in Kontakt kam. Zur Solidarität mit dem Kollegen rief etwa die gewerkschaftliche Basisinitiative „Sagt NEIN!“ auf, die sich in der Verdi-Gewerkschaft für eine Opposition gegen den Aufrüstungskurs der BRD stark macht.
Und ein Experte für Antirassismus wie der ehemalige Hochschullehrer Georg Auernheimer nahm im Gewerkschaftsforum dazu ebenfalls Stellung: Die formaljuristische Argumentation des Arbeitgebers täusche darüber hinweg, dass hier „Protest gegen die Waffentransporte an Israel, eine politische Handlung also, geahndet werden“ soll.
Die neuesten Umdeutungen wie die von der „International Holocaust Remembrance Alliance“ (IHRA) vorgeschlagene „Arbeitsdefinition“ spielen dabei eine wichtige Rolle, um Kritik an israelischer Politik als Antisemitismus zu identifizieren. Solche Umdeutungen wurden, so Auernheimer, „von den europäischen Regierungen und den USA übernommen, was eine Verfolgungspraxis zur Folge hat, die fast dem hysterischen Antikommunismus der McCarthy-Ära in den USA vergleichbar ist.“ Diese hysterische Atmosphäre, die in Deutschland noch einmal besonders hochgekocht ist, hat ja in den beiden letzten Jahren mit diversen Ausladungen, Einreiseverboten, Kündigungen von sich reden gemacht. Das hat immerhin zur Folge, dass es seit Kurzem, siehe etwa den Zuspruch zur großen palästinasolidarischen Demo im Berlin, vielen Leuten zu viel wird. Tja, „besser spät als nie“!
Problemfall „Israelbezogener Antisemitismus“
Auernheimer hat seine Position jetzt in einer Streitschrift ausführlich begründet (daraus die folgenden Zitate). Sie trägt den Titel „Zweierlei Antisemitismus“, der vielleicht etwas missverständlich ist. Denn sie will ja nicht, wie in der BRD derzeit üblich, die alte von rechts kommende Judenfeinschaft um eine neue („linke“, „islamische“, „propalästinensische“, „importierte“…) Variante ergänzen und an dieser die Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens festmachen. Im Gegenteil, sie greift die gegenwärtige, angeblich allein auf den Schutz der jüdischen Bevölkerung und des israelischen Staates bedachte Regierungslinie als eine Abwehr von kritischen Nachfragen an, die aktuell – aber auch schon seit der in Deutschland weitgehend ausgeblendeten Nakba der 1940er Jahre – an die zionistische Politik zu adressieren wären; sie nimmt also eine politische Heuchelei ins Visier, die hemmungslos ein bundesdeutsches Tabu benutzt.
„Antisemitismus, früher ein Kampfbegriff gegen die Diskriminierung und Entrechtung von Juden, einer schwachen, bedrängten Minderheit, ist zu einem Schild zur Abwehr von Kritik an Israels Politik geworden, eines hochgerüsteten und über Atomwaffen verfügenden Staates, der ein Volk unterdrückt und entrechtet.“ (S. 96f) So lautet die Kernthese der neuen Veröffentlichung. Was etwa mit den Bundestagsbeschlüssen zur Übernahmen der IHRA-Definition oder zum Boykott der BDS-Bewegung in Gang gesetzt wurde, atme „den Geist des Obrigkeitsstaates“ (S. 128) und zeichne sich durch repressive Maßnahmen aus, die der antirassistischen Bildungsarbeit oder der Aufklärung über Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einen Bärendienst erweisen. Mit dem unbedingten Schutz von Juden und Jüdinnen habe dies jedenfalls nichts zu tun.
Die Streitschrift Auernheimers ist natürlich keine erschöpfende Darstellung der Geschichte und Systematik seines Gegenstandes (wozu ja viele Wissenschaftsdisziplinen das Ihre beigetragen haben), sondern ein knapper, gelungener Problemaufriss. Er beginnt mit einem Kapitel über den Stand der heutigen Kontroversen (Redaktionsschluss: April 2025) und zeigt die Mängel der IHRA-„Arbeitsdefinition“ auf, die von der Bundesregierung mit ihren einschlägigen Beschlüssen zur verbindlichen Grundlage des heutigen Verständnisses gemacht wurde. Bemerkenswert übrigens, dass ein politisches Gremium definitorisch festlegt, auf welcher Basis Wissenschaftler oder Bildungseinrichtungen sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinanderzusetzen haben. Für die Praxis politischer Bildung hat das jedenfalls fatale Folgen: Im Grunde werden Pädagogen und Pädagoginnen dazu aufgefordert, abweichende Meinungen auszugrenzen, gegebenenfalls zu melden, statt in eine produktive Auseinandersetzung mit ihren Adressaten einzutreten.
Die hier geleistete „Fokussierung auf ‚israelbezogenen Antisemitismus‘ schafft Unklarheit über die tatsächliche Verbreitung von Antisemitismus und Verwirrung bei seiner Bekämpfung“ (S. 17) lautet die Schlussfolgerung des Autors. Er befasst sich auch näher mit dieser Verbreitung in der BRD, die seit der Nachkriegszeit traditionell aus dem rechten und rechtsradikalen Lager gespeist wird und mittlerweile eine Verstärkung aus der migrantischen Szene – als Nachwirkung des Nahostkonflikts – erfährt. Diese neueren Tendenzen dürften aber nicht überbewertet werden und vor allem nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Antisemitismus ein genuin europäisches Produkt ist und in Deutschland vor und während der Nazizeit seine politische Rolle gespielt sowie in der BRD seine Fortsetzung – nicht nur am rechten Rand – gefunden hat. Daher ist festzuhalten:
Antisemitismus wurde als rassistisches Konzept mit der Durchsetzung der kapitalistischen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert explizit in die Politik eingeführt, griff dabei auf die christliche Tradition der Judenfeindschaft des Mittelalters zurück und wurde im 20. Jahrhundert durch den Faschismus, vor allem in Deutschland, aber auch anderswo, in die Radikalform eines Vertreibungs- und Ausrottungsprogramms überführt. Man muss die damit propagierte Volkskunde, darauf legt der Autor Nachdruck, als Rassismus verstehen, also nicht als bloßes (Ab-)Qualifizieren von Äußerungen oder Handlungen eines Kollektivs, sondern als Urteil, das über die Menschen- bzw. Volksnatur gefällt wird und somit das unveränderliche Wesen der betreffenden Personen erfassen will – ursprünglich in einer streng biologistischen Fassung, heute, seitdem die „Rassenkunde“ durch den Nationalsozialismus diskreditiert ist, auch gerne mit kulturalistischen Elementen angereichert.
Eine geläuterte Nation?
Ein eigenes Kapitel in der neuen Veröffentlichung thematisiert dazu den Antisemitismus im Blick auf den Rassismusbegriff und die verschiedenen Theorieansätze, ein weiteres zeigt die Entstehung dieser rassistischen Konzeption vom Antijudaismus der Feudalepoche über die Judenemanzipation im modernen Nationalstaat bis zum Aufwerfen der Rassenfrage im Zeitalter des Imperialismus und zu ihrer „exterminatorischen“ Zuspitzung im 20. Jahrhundert. Das umfangreichste Kapitel trägt dann die Überschrift „Die Bundesrepublik und die Last des Holocaust“. Es verdeutlicht die Hauptlinie von Auernheimers Argumentation: Der westdeutsche Staat habe die Untaten der Nazidiktatur, deren Nachfolge er ja antrat, zuerst verdrängt und dann mehr nolens als volens in einer Vergangenheitsbewältigung so aufgearbeitet, dass ein neuer geläuterter Nationalismus wieder möglich wurde. Der wurde zum Ausweis der eigenen Güte: Deutschland als Weltmeister und Vorbild nationaler Sühne!
Das neue nationale Selbstbewusstsein schlug dann nach der Wiedervereinigung teils mit seinen Schlussstrich-Forderungen (Walsers Paulskirchenrede, Augsteins Kritik am Holocaustmahnmal…) über die Stränge, führte aber im Endeffekt zu einem ritualisierten Gedenken, das die politische Klasse der BRD heutzutage professionell betreibt und das sie als bedingungsloser Bündnispartner des israelischen Staates von jedem rassistischen Makel freisprechen soll. Politisch wurde somit einer aufstrebenden europäischen Führungsmacht ihr Imageschaden (verantwortlich für ein „singuläres“ Menschheitsverbrechen!) repariert und auf der persönlichen Ebene eine Schuldabwehr ermöglicht, die jetzt im Fremden – bevorzugt im von rechts problematisierten muslimischen Migranten – den „Importeur“, also den eigentlichen Urheber des Antisemitismus identifiziert.
Einige kurze Kapitel zu „Stigmamanagement und Strategien der Schuldabwehr“, zur Unhaltbarkeit eines Generalverdachts gegenüber muslimischen Jugendlichen und zu den Aufgaben bzw. Schwierigkeiten politischer Bildung beschließen das Buch; die Überlegungen werden auch noch einmal in neun abschließenden Thesen auf den Punkt gebracht. Dabei fasst die Schlussthese das Bedenken gegenüber der unbedingten Israel-Solidarität, die zumindest bis zum Herbst 2025 Regierungsleitlinie der BRD ist, so zusammen: „Die vorbehaltlose Verteidigung der israelischen Besatzungspolitik und der genozidalen Kriegsführung, die Diskreditierung jeder Kritik als Antisemitismus, fördert die Straflosigkeit für Völkerrechtsbrüche und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und damit einen allgemeinen Rechtsnihilismus“. (S. 134)
Antisemitismus kommt von außen?
Auernheimers Studie erhebt, wie gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei dieser Materie wäre das auch ein hoffnungsloses Unterfangen. Es gibt aber zahlreiche Literatur- und Quellenverweise, die weitergehende Information ermöglichen. Das neue Antisemitismuskonstrukt, das in der BRD quasi regierungsoffiziell Gültigkeit hat, destruiert die Studie treffend im Blick auf den angeblichen „Import“ aus arabischen oder muslimischen Ländern. Sie erinnert auch daran, dass es in der muslimischen Welt des Mittelalters und der Neuzeit keinen genuinen Antisemitismus gab, dass dieser etwa im Nahen Osten, von wenigen Ausnahmen abgesehen (siehe z.B. den Mufti von Jerusalem), erst mit den neuen Nationalbewegungen, mit dem Konflikt um die israelische Staatsgründung und der Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aufkam.
Vielleicht hätte man in diesem Kontext auch noch die Variante des ‚linken Antisemitismus‘ in den Blick nehmen können, die etwa vor dem Hamas-Massaker vom Oktober 2023 in der BRD eine gewisse Rolle gespielt hat. Dabei wurde – das Klischee vom jüdischen Selbsthass leistet da gute Dienste – der Jude Karl Marx wegen seines Aufsatzes „Zur Judenfrage“ als Antisemit geoutet. Eine üble Nachrede, zu der gerade Hannah Arendt, man muss sagen: wider besseres Wissen, beigetragen hat. In ihrer Totalitarismustheorie hat sie die Rede vom ‚linken Antisemitismus‘ populär gemacht, wobei in der Sache der kleinbürgerliche Radikalismus gemeint ist und eben nicht die sozialistische Arbeiterbewegung, die mit dem Aufwerfen der Klassenfrage gerade den Antipoden zum bürgerlichen Räsonnement über die Rassenfrage bildete.
Auernheimer ordnet den Antisemitismus in den Rassismus ein, hält natürlich die Besonderheiten fest, die ihn mit seiner mehr als 1000jährigen (Vor-)Geschichte auszeichnen. Doch welcher Rassismus hat nicht seine besonderen Merkmale? Im Fall der Judenfeindschaft muss man deswegen nicht auf die These einer „Singularität“ des Holocausts verfallen – und ihr auch keinen exklusiven Status einräumen, der sie aus den allgemeinen antirassistischen Bemühungen ausklammert und etwa das Studium des jüdischen Lebens und seiner Tradition zur Pflicht macht oder die spezielle Religiosität mit ihren Übergängen in den politischen Fundamentalismus der Kritik entzieht. Strukturell ist der antijüdische Rassismus gar nicht groß verschieden von einem antimuslimischen oder antislawischen.
An Letzteres muss man in Deutschland wohl besonders erinnern, denn der rassistische Vernichtungskrieg, den die deutsche Wehrmacht gegen Sowjetrussland führte und der 27 Millionen Menschen das Leben kostete, hat sich in die (west-)deutsche Erinnerungskultur nicht „eingebrannt“, wie Bundespräsident Steinmeier 2021 zum Gedenken an 80 Jahre „Unternehmen Barbarossa“ feststellte. Sechs Millionen tote Juden verpflichten uns Deutsche dagegen bedingungslos, einem Staat, in dem heute ein Teil der jüdischen Weltbevölkerung lebt, die Treue zu halten und dessen Bedrohungsgefühle zu teilen, wenn er sich etwa in einem völkerrechtswidrigen Angriffs gegen einen Rivalen wendet. 27 Millionen Tote verpflichten die BRD dagegen zu überhaupt nichts. Und dass im Nachfolgestaat der Sowjetunion Deutschland heute als eine bedrohliche Macht empfunden wird, kann ein Politiker der hochgerüsteten BRD nur lachhaft finden.
———–
Der Autor:
Johannes Schillo ist Sozialwissenschaftler und Journalist und war lange Jahre als Redakteur in der außerschulischen Bildung tätig; letzte Veröffentlichung zusammen mit N. Wohlfahrt, „Deutsche Kriegsmoral auf dem Vormarsch“.
Bild: Papy Rossa