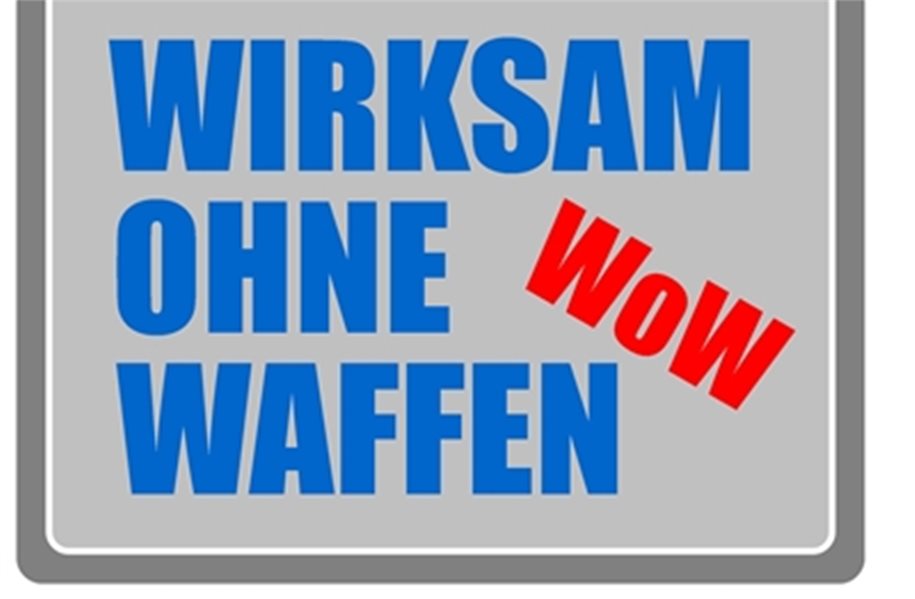 Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die NATO-Staaten angekündigt, neue Milliarden in die Rüstung zu stecken; Truppen und Waffensysteme werden nach Osteuropa verlegt. Aber was ist, wenn die Abschreckung versagt? Ein Krieg in Europa, dann wahrscheinlich auch mit Atomwaffen? Und wann hört Verteidigung auf, legitim zu sein? Denn irgendwann gibt es nichts mehr zu verteidigen, sondern es heißt dann nur noch „gemeinsam in den Abgrund“, wie der Sozialpsychologe Friedrich Glasl die letzte Stufe seiner Konflikteskalationsleiter so treffend genannt hat. Sind wir wirklich zurück zum Slogan „Freiheit oder Tod?“.
Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die NATO-Staaten angekündigt, neue Milliarden in die Rüstung zu stecken; Truppen und Waffensysteme werden nach Osteuropa verlegt. Aber was ist, wenn die Abschreckung versagt? Ein Krieg in Europa, dann wahrscheinlich auch mit Atomwaffen? Und wann hört Verteidigung auf, legitim zu sein? Denn irgendwann gibt es nichts mehr zu verteidigen, sondern es heißt dann nur noch „gemeinsam in den Abgrund“, wie der Sozialpsychologe Friedrich Glasl die letzte Stufe seiner Konflikteskalationsleiter so treffend genannt hat. Sind wir wirklich zurück zum Slogan „Freiheit oder Tod?“.
Von Christine Schweitzer
Es waren solche Fragen nach der Sinnhaftigkeit militärischer Verteidigung, die Friedensforscher*innen – und auch einige Militärs wie den Briten Stephen King-Hall – dazu gebracht haben, nach dem 2. Weltkrieg über Alternativen nachzudenken. Ihre Antwort mag utopisch klingen, basiert aber auf realen Erfahrungen in vielen Ländern der Erde mit erfolgreichem gewaltfreien, zivilen Widerstand.
Der Fachbegriff: Soziale Verteidigung. Ihre Grundidee: Keine bewaffnete Verteidigung der Grenzen und des Territoriums, sondern der Lebensweise und der Institutionen durch zivilen Widerstand.
In King-Halls Worten: „Ich aber vertrete nun einmal die Ansicht, dass ein Land mit feindlicher Besetzung besser dran ist als ein Land in Schutt und Asche. Wenn wir also vor diese Alternative gestellt werden, dann halte ich es für klüger, mutiger und demokratischer, sich, wenn auch schweren Herzens, für die Besatzung zu entscheiden. Wer sich anders entscheidet und es vorzieht, zu einer Handvoll radioaktiver Asche zu werden, den will ich nicht davon abhalten, Selbstmord zu begehen. Nichts aber berechtigt ihn, auf eine Gesetzgebung oder auf politische Entscheidungen zu drängen, die zu einem Massenselbstmord der ganzen Nation führen könnten.“[1]
Der Anstoß zur Entwicklung des modernen Konzepts der Sozialen Verteidigung kam neben von King-Hall zuerst von jungen Wissenschaftler*innen aus Großbritannien (u.a. Adam Roberts, April Carter), den USA (Gene Sharp) und den skandinavischen Ländern (u.a. Johan Galtung). [2] Zu diesem Kreis stieß recht früh der deutsche Politologe Theodor Ebert hinzu, der über Gewaltfreie Aktion promovierte und an einer Initiative zur Schaffung einer „Friedensarmee“ nach Vorbild Gandhis beteiligt war. Er wirkte über mehrere Jahrzehnte in der Friedensbewegung und in der Evangelischen Kirche und setzte sich für die Einführung von Sozialer Verteidigung durch die Bundesregierung ein.
Beispiele Sozialer Verteidigung aus Deutschland
Wenn es um Soziale Verteidigung in Deutschland geht, dann muss auch erwähnt werden, dass ausgerechnet in diesem Land, das nicht gerade durch Aufmüpfigkeit gegen die Oberen bekannt ist, zwei der „klassischen“ Beispiele Sozialer Verteidigung herstammen: Der Kapp-Putsch 1920 von Offizieren gegen die junge Weimarer Republik wird gerne als ein Beispiel erfolgreichen zivilen Widerstands gegen Putschisten zitiert. Vor allem ein Generalstreik war entscheidend dabei, dass die Putschisten nach wenigen Tagen aufgaben. Das zweite Beispiel ist der Ruhrkampf 1923 gegen die Besatzung des Ruhrgebietes durch Frankreich und Belgien mit dem Ziel, ausbleibende Reparationszahlungen für die Zerstörungen und das Leid, das Deutschland im Ersten Weltkrieg über beide Länder gebracht hatte, einzutreiben. In ihm kam erneut das Engagement von Gewerkschaften zum Tragen, hier aber unterstützt von der Reichsregierung, die aus der Ferne versuchte, den Widerstand vor Ort zu unterstützen. Er kam nach einigen Monaten zum Erliegen; kurze Zeit später kam es aber zu Verhandlungen, die die Last der Reparationen begrenzten, sodass der Widerstand doch als teilweise erfolgreich eingestuft werden kann.[3]
Höhepunkt des Interesses: Die Friedensbewegung der 1980er Jahre und der Niedergang danach
In den 1980er Jahren, der Zeit der großen Friedensbewegung gegen die sog. „Nachrüstung“ mit Mittelstreckenraketen, stieß Soziale Verteidigung – neben militärischen Alternativkonzepten – als Verteidigungskonzept, das eine radikale Abrüstung begleiten sollte, auf recht großes Interesse. Kriegsdienstverweigerer brachten es vor den Kommissionen vor, vor denen sie begründen mussten, warum sie keinen Wehrdienst leisten wollten. Friedensinitiativen beschäftigten sich mit dem Konzept und machten es über die Kreise der Friedensforschung hinaus populär. Und in der Schweiz – und bald auch in Deutschland – wurde über die Abschaffung des Militärs nachgedacht. In der Schweiz mündete das in ein Volksreferendum 1989, bei dem immerhin fast 36% der Bevölkerung für eine Schweiz ohne Armee stimmten!
Gleichzeitig entstanden in den 1980er Jahren auch einige neue Studien, vor allem solche historischer Art. So trug der Historiker Jacques Semelin mit seiner Forschung über zivilen Widerstand im Zweiten Weltkrieg wesentlich dazu bei, zu zeigen, dass auch gegen menschenverachtende Besatzungsregimes wie die der deutschen Nazis gewaltfreier Widerstand möglich war. Dies war – und ist – ein wichtiges Argument in der Diskussion um Soziale Verteidigung, denn früher oder später wird stets der Einwand laut, dass gegen menschenverachtende Regimes ziviler Widerstand sinnlos sein.
Höhe- und gleichzeitig vorläufiger Endpunkt des Interesses in Deutschland im 20. Jahrhundert war eine Tagung mit dem Titel „Wege zur Sozialen Verteidigung“, zu der 1988 über 1.000 Menschen in Minden (Ostwestfalen) zusammenkamen. In ihrer Folge wurde dann der, noch heute bestehende, Bund für Soziale Verteidigung gegründet.
Nach der sogenannten „Wende“ 1989 – dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts und der Sowjetunion und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten – wurde es still um die Soziale Verteidigung. Das Militär der NATO wandte sich ausschließlich Kriegseinsätzen im Globalen Süden zu. Die traurigen Höhepunkte waren die Angriffskriege auf Afghanistan und den Irak. Viele der Protagonist*innen der internationalen Friedensforschung, die zuvor sich mit Sozialer Verteidigung befasst hatten, wandten sich anderen Themen, besonders gewaltfreien Aufständen gegen Diktaturen, zu. Und schließlich wuchs eine jüngere Generation von Wissenschaftler*innen heran, die der Begriff der Sozialen Verteidigung nicht mehr benutzen, weil – hier kann nur gemutmaßt werden – er ihnen entweder nicht mehr bekannt ist oder sie ihn wegen seines militärkritischen politischen Kontexts ablehnen. Doch ist in diesen letzten zwanzig Jahren ein reicher Fundus an Studien über zivilen Widerstand entstanden, der erst noch mit dem Konzept der Sozialen Verteidigung neu in Verbindung gebracht werden muss, dann aber wesentlich zu seiner Anpassung an das 21. Jahrhundert beitragen kann.
Erst seit etwa 2014 ist das Thema der gewaltfreien Verteidigung wieder in den Vordergrund gerückt und spiegelt die politischen Trends zurück zum Ost-West-Konflikt (unter neuen Vorzeichen) und Landesverteidigung wider. Es könnte sein, dass wir in einer neuen Phase der Weiterentwicklung des Konzepts der Sozialen Verteidigung angekommen sind.
Kampagne Wehrhaft ohne Waffen
Mit dem Ukraine-Konflikt seit 2014 ist in Deutschland das Interesse an diesem Konzept wieder erwacht. 2018 und 2023 fanden, organisiert vom Bund für Soziale Verteidigung, zwei Konferenzen, die das Konzept der Sozialen Verteidigung neu beleuchteten. Und im September 2024 fand (online) eine wissenschaftliche Konferenz mit weltweiter Beteiligung zum Thema Soziale Verteidigung statt.
Im Sommer 2022 gründete ein Kreis von Aktivist*innen rund um den Bund für Soziale Verteidigung die Kampagne „Wehrhaft ohne Waffen“. Sie will über Soziale Verteidigung informieren, Druck erzeugen und sie in drei sog. „Modellregionen“ konkret vorbereiten. Denn eine umfassende und menschliche Verteidigung muss an Ort und Stelle vorbereitet und erlebt werden. Sie kann nicht „von oben“ angeordnet werden. Die drei Modellregionen sind in ihrer Ausrichtung recht unterschiedlich. Im Wendland, einer Region im Nordwesten Deutschlands, die durch Jahrzehnte des Widerstands gegen die Lagerung von Atommüll geprägt ist, geht es vor allem um den Widerstand gegen Rechtsextremismus. Die Vorbereitung auf eine eventuelle Machtergreifung durch die deutschen Rechtsextremen, die „Alternative für Deutschland“ (AfD), wird von den Aktiven als Vorbereitung auf Soziale Verteidigung gegen andere – militärische – Bedrohungen gesehen.
In Berlin ist es eine Kommune, evangelische Kirchengemeinde und ein Ort für Nachbarschaft, Politik und Kunst, der REFORMATIONS-Campus e.V. Sie verbindet ihren christlichen Glauben mit Gesellschaftstransformation. Bei ihrer Arbeit geht es in erster Linie um Resilienz in verschiedenen Feldern – Klimawandel, Menschenrechte und Überwindung von Gewalt. Eine Arbeit, die sie in den Kontext der Sozialen Verteidigung stellen.
Für ein französisches Publikum vielleicht von besonderem Interesse ist die dritte Modellregion, der Oberrhein. Denn sie ist grenzübergreifend tätig und hat Partnerschaften in Frankreich und der Schweiz. Dort wird mehr im klassischen Sinne „Öffentlichkeitsarbeit“ gemacht – Veranstaltungen, Vorträge, Friedensfeste, bei denen über Soziale Verteidigung informiert wird.[4]
Dicke Bretter bohren
In Deutschland ist die Friedensbewegung insgesamt, nicht nur ihr kleiner Ausschnitt, der sich für das radikale Konzept der Sozialen Verteidigung einsetzt, marginalisiert. Regierungs- wie bürgerliche Oppositionsparteien vertreten einmütig einen Kurs von Aufrüstung (inkl. mit neuen Atomwaffen und Mittelstreckenwaffen) und Waffenlieferungen an die Ukraine und Israel. Dazu kommt eine zu beobachtende Kriegsvorbereitung der gesamten Gesellschaft mit Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht, Propaganda des Militärs in Schulen, Vorbereitung ziviler Infrastruktur wie Krankenhäusern auf den Kriegsfall) unter dem Begriff „kriegstüchtig“ werden. Kritische Stimmen werden rasch mit massiver Kritik oder Häme überzogen, Pazifist*innen pauschal als „Russlandfreund*innen“ diffamiert oder als unverantwortliche Gesinnungsethiker*innen bezeichnet. Die Lage wird nicht dadurch einfacher gemacht – hier mag sich die Situation von der in Frankreich unterscheiden – dass zwei rechtsextreme und populistische Parteien die einzigen nennenswerten Parteien sind, die Kritik an diesem Kurs der anderen Parteien üben. Weit entfernt davon, gewaltfreie Positionen zu vertreten, stellen sie sich eher auf die Seite Russlands und fordern das Ende der Unterstützung der Ukraine. Leider gibt es zwischen zumindest einer von ihnen und Gruppen, die sich der Friedensbewegung zurechnen, nicht nur inhaltliche, sondern auch personelle Überschneidungen.
Aber der Artikel soll doch mit einem Ausdruck von Hoffnung enden: Die Erfahrung sozialer Bewegungen aus den letzten 100 Jahren lehrt, dass Bewegungen Wellenbewegungen sind. 1978 hätte es kaum jemand für möglich gehalten, dass zwei Jahre später angesichts der angekündigten Stationierung von Mittelstrecken-Atomwaffen in Europa Millionen auf die Straße gehen würden. Arbeit an gewaltfreien Alternativen zu Rüstung und Militär kann der Arbeit von Bauern verglichen werden, die auch erst einmal den Boden bereiten müssen, bevor die Frucht ausgesät werden kann und dann reift.
————————
Anmerkungen:
[1] Stephen King-Hall, King-Hall, Stephen (1958): Den Krieg im Frieden gewinnen. Hamburg: Henri Nannen Verlag
[2] Für die ersten Phasen, siehe Bogdonoff , Philip (1982) Civilian-Based Defense: A Short History, https://www.bmartin.cc/pubs/19sd/refs/Bogdonoff1982.pdf
[3] Siehe dazu Müller, Barbara (1995): Passiver Widerstand im Ruhrkampf. Eine Fallstudie zur gewaltlosen zwischenstaatlichen Konfliktaustragung und ihren Erfolgsbedingungen. Münster: Lit-Verlag
[4] Siehe die Website www.wehrhaftohnewaffen.de.
————————
Die Autorin:
Dr. Christine Schweitzer war bis Februar 2025 Geschäftsführerin beim Bund für Soziale Verteidigung (soziale-verteidigung.de) und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Friedensarbeit und gewaltfreie Konfliktaustragung (ifgk.de).
Dieser Artikel ist Teil des Dossiers Gewaltfreier Zivilschutz, Nummer 213 (Spezial), Dezember 2024, der Zeitschrift Gewaltfreie Alternativen. Bild: WOW www.wehrhaftohnewaffen.de.