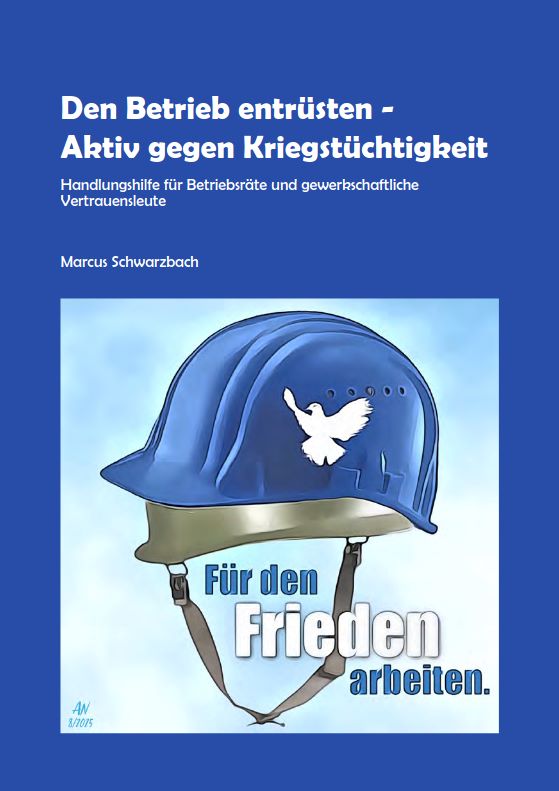 Krise setzt Beschäftigte unter Druck – eine Handlungshilfe soll Betriebsräten Mut machen
Krise setzt Beschäftigte unter Druck – eine Handlungshilfe soll Betriebsräten Mut machen
Von Marcus Schwarzbach
Die Bundesregierung treibt die Militarisierung der Gesellschaft voran. Dies ist auch bei Unternehmensplanungen und Firmenübernahmen oder Beteiligungen spürbar. Beispiele für zivile Betriebe, die von Rüstungskonzernen übernommen werden, gibt aktuell einige: Der Wismarer Standort der MV Werftengruppe wird in ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) eigegliedert. Das Görlitzer Werk des Bahnwaggonbauer Alstrom wird von Panzerbauer KNDS übernommen, Rheinmetall hat Interesse an VW-Werken, die von der Schließung bedroht sind.
Von ziviler Herstellung zu militärsicher, lautet die politische Vorgabe. In den 1980er Jahren war dagegen Rüstungskonversion ein wichtiges Thema. Damals haben friedenspolitisch engagierte IG-Metall-Arbeitskreise für Rüstungskonversion geworben und Konzepte entwickelt, wie Waffenfabriken auf zivile Produkte umgestellt werden. Im Herbst 1981 gründete sich der erste Arbeitskreis Alternative Produktion bei der Blohm und Voss AG in Hamburg, andere folgten.
Es gibt viele Gründe für Konversion.
Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie sind unsicherer als in vielen anderen Branchen. De Nachfrage ist von politischen Entscheidungen abhängig – internationale Entspannung kann zu einem Rückgang der Nachfrage und zu Arbeitsplatzverlusten führen. Viele Angestellte wollen, dass ihr Beruf auch privat hohes Ansehen hat; was schwer möglich ist bei einer Branche, die davon lebt, dass kein Frieden herrscht.
Protest in dieser Form ist eher selten. Die Umwandlung von ziviler Produktion in militärischer scheint Normalität zu werden. Der Begriff „Konversion“ scheint dabei in Vergessenheit zu geraten: „Mit dem Begriff Rüstungskonversion bezeichnet man den Vorgang einer Umstellung von militärisch genutzten Anlagen und Produktionsmitteln auf zivile Nutzung und die Produktion ziviler Güter. Mit einer solchen, breiten Definition sind sowohl Fälle erfaßt, in denen zuvor militärisch genutzte Geräte und Gebäude nun zivilen Gebrauch finden, als auch Umstellungsprozesse innerhalb der Rüstungsindustrie, z. B. von der Produktion von Wannen für Kampfpanzer auf Müllcontainer aus Metall.“, schreibt Peter Wilke im Standardwerk Frieden: Ein Handwörterbuch, Herausgeber: Ekkehard Lippert, Günther Wachtler (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-85630-2_33#:~:text=Zusammenfassung,%2C%20R%C3%BCstung%2C%20Technik%2C%20Waffen).
Auch in der Wissenschaft wird die militärische Ausrichtung vorangetrieben. Beim Hamburger Forschungszentrum Desy gibt es Planungen, „sicherheitsrelevante Forschung“ zu betreiben. Dies führt zu Protest bei den Beschäftigten. Eine Gruppe namens „Science4Peace@Desy“ sammelt Unterschriften in der Belegschaft und betreibt Öffentlichkeitsarbeit, die sich gegen Forschung mit militärischen Zielen aussprechen. Sie fordern, den offiziellen Leitgedanken der DESY beizubehalten: „Unsere Forschung verfolgt Ziele, die friedlich sind und der Zivilgesellschaft dienen.“ (https://science4peacedesy.de/index.html)
Heute scheint bei Beschäftigten ein Gefühl der „Alternativlosigkeit“ vorzuherrschen, der politische Rechtsruck stärkt nicht nur Militär. Vielmehr will die Bundesregierung auch soziale Rechte einschränken. „Wir müssen ran an die sozialen Sicherungssysteme“, sagt Bundeskanzler Merz (www.n-tv.de/politik/SPD-beklagt-Merz-Attacken-gegen-unseren-Sozialstaat-article25999256.html). Geflüchtete erhalten statt Bargeld Bezahlkarten, Bürgergeldbezug soll erschwert, der 8-Stunden-Arbeitstag nach Arbeitszeitgesetz abgeschafft werden. Für viele scheint deshalb eine Umstellung auf Rüstungsproduktion als „kleineres Übel“ im Vergleich zur Arbeitslosigkeit.
Neue Broschüre von IMI
Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. in Tübingen hat eine Handlungshilfe für Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauensleute veröffentlicht:
Informationsstelle Militarisierung (IMI) » Den Betrieb entrüsten – Aktiv gegen Kriegstüchtigkeit
Gerade in den heutigen Zeiten der medialen und regierungsoffiziellen Militärbegeisterung soll Beschäftigten Mut gemacht werden, Alternativen zur Rüstungsproduktion zu erarbeiten.
Das Gesetz bietet jedoch dem Betriebsrat durchaus Möglichkeiten, unternehmerische Planungen kritisch zu hinterfragen. Besondere Bedeutung haben für Betriebsräte die Möglichkeiten zur Beschäftigungssicherung nach § 92 a BetrVG, die einen Verhandlungsanspruch enthalten, ohne dass bereits ein Sozialplan angestrebt werden muss. Das Vorschlagsrecht kann jederzeit eingesetzt werden, um der Gefährdung von Arbeitsplätzen vorzubeugen. Aus Sicht der Betriebsräte kann diese Regelung genutzt werden, um über Gegenvorschläge zur geplanten Umstellung der Produktion auf Rüstungsgüter zu verhandeln. Denn Vorschläge nach § 92 a BetrVG können auch Alternativen zum Produktions- und Investitionsprogramm sein. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält er die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies zu begründen. Das Vorschlagsrecht ist also begrenzt, kann aber eingesetzt werden, um deutlich zu machen: Alternativen sind möglich. Es können auch andere Produkte als Militärware hergestellt werden.
Einbezug der Belegschaft
Ideen können in Sitzungen des Betriebsrates erarbeitet werden. Dabei ist auch die Belegschaft nicht zu vergessen, sie sollte motiviert werden, eigene Vorschläge einzureichen. Aufrufe können über eine Betriebsversammlung, persönliche Ansprache in betroffenen Abteilungen oder per Intranet erfolgen. Den Beschäftigten sollte klar sein, welches Betriebsratsmitglied für Fragen vor Ort zur Verfügung steht. Über diese Vorschläge aus der Belegschaft kann dem Unternehmen deutlich gemacht werden, dass die vom Betriebsrat vorgetragenen Vorstellungen denen der Belegschaft entsprechen.
Diskussionen über ein Gegenkonzept zuspitzen
Vorschläge nach § 92 a BetrVG kann die Unternehmensleitung ablehnen. Diskussionen über sein Gegenkonzept zur Militarisierung der Produktion kann der Betriebsrat jedoch nutzen, um den Zusammenhang zwischen Rüstungsausgaben und Sozialabbau herzustellen. Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauensleute können die Diskussionen im Betrieb über eine andere Art der Produktion aufgreifen, um zu verdeutlichen: Alternativen sind möglich, der Weg der Militarisierung ist eine politische Fehlentscheidung, die auch rückgängig gemacht werden kann.
———–
Näheres gibt es auf der Homepage: https://www.imi-online.de/2025/10/20/den-betrieb-entruesten-aktiv-gegen-kriegstuechtigkeit/