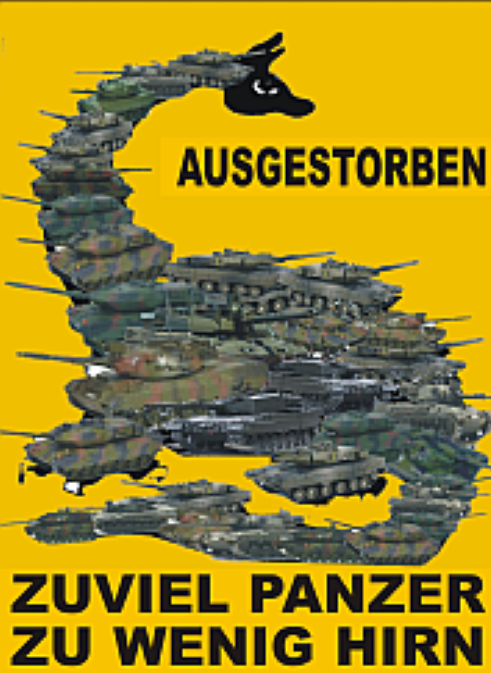Am 10. Juli 2024 schlug eine deutsch-amerikanische Erklärung ein wie eine Bombe, derzufolge bis 2026 diverse US-Mittelstreckenwaffen hierzulande unter US-Kommando stationiert werden sollen.
Insofern überraschte Mitte Juli 2025 die Ankündigung, Deutschland habe eine Anfrage für den Erwerb des US-Startsystems Typhon gestellt, mit dem genau solche Tomahawk-Marschflugkörper und SM-6-Raketen abgefeuert werden können, die bereits voriges Jahr Gegenstand der US-Stationierungspläne waren.
Ob die Typhon-Systeme deshalb als Alternative oder Ergänzung zu etwaigen unter direktem US-Kommando stehenden Mittelstreckenwaffen gedacht sind, ist eine entscheidende Frage, die allerdings so oder so am gefährlichen Charakter dieser Systeme nichts ändert. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, plant die Bundesregierung parallel dazu auch die Entwicklung einer eigenen »Abstandswaffe« für Angriffe tief im russischen Raum, weshalb es für die sich formierenden Gegenkampagnen reichlich zu tun gibt.
Verteidigung durch Angriff?
Um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, versicherte Verteidigungsminister Boris Pistorius selbstredend umgehend, man hege mit den Typhon-Kaufplänen keinerlei offensive Absichten, alles diene nur der Verteidigung – der Haken an der Sache: Moskau kann sich auf derlei Verlautbarungen nicht verlassen, zumal genau das Typhon-Waffensystem für Angriffe tief im russischen Raum geradezu prädestiniert ist, dürfte Russland davon ausgehen, dass genau dies der Zweck sein soll. Das ist der Stoff, aus dem gefährliche Rüstungsspiralen gemacht sind!
Eine Typhon-Batterie besteht aus vier LKWs auf der jeweils vier Startrampen montiert sind, von denen aus jeweils eine Rakete oder ein Marschflugkörper verschossen werden kann. Infrage kommen dafür zwei Waffentypen: Entweder die Standard Missile 6 (SM-6), eine ballistische Flugabwehrrakete mit – relativ – kurzer Reichweite von 370 km und einer Bodenangriffsfähigkeit von derzeit 460 km laut US- bzw. 740km nach russischen Angaben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde aber die in Entwicklung befindliche Variante 1B beschafft werden, die über eine Hyperschallfähigkeit (schneller als 6.175 km/h) und eine Reichweite von 1.600km verfügen soll. Als zweites System käme derTomahawk in Frage, der zwar relativ langsam (rund 900 km/h), aber als Marschflugkörper extrem tief und hochgradig manövrierbar fliegt. Für gegnerische Abwehrsysteme ist er damit nur schwer zu bekämpfen, wodurch bei einer Reichweite je nach Modell von 1.700km bis 2.500km Angriffe auf Ziele in Russland, einschließlich St. Petersburg und Moskau möglich würden.
Über Zahl und Kosten der ins Auge gefassten Systeme hält sich das Verteidigungsministerium bedeckt, betont wird dagegen, dass es sich um konventionelle Waffen handele. Und tatsächlich sind weder Tomahawk noch SM-6 – zumindest auf absehbare Zeit – atomar bestückbar, überaus gefährlich sind sie aber trotzdem. Das „Entscheidende“, so Pistorius, sei „die Reichweite dieser Waffensysteme“, die „deutlich größer“ sei, als alles, was bislang in Europa verfügbar wäre, wodurch eine wichtige Fähigkeitslücke geschlossen würde. Tatsächlich handelt es sich hierbei im Gegensatz zu bereits in großer Zahl vorhandenen luft- oder seebasierten Mittelstreckenwaffen um landgestützte Systeme, die aus gutem Grund bis zur US-Aufkündigung des INF-Vertrages im Februar 2019 verboten waren. Denn see- und luftgestützte Waffen brauchen länger, um ihr Ziel zu erreichen, es bleibt Zeit für die Lagefeststellung und für einen etwaigen Gegenschlag, sie sind damit per se nur bedingt offensiv für Überraschungsangriffe auf strategische Ziele (Radaranlagen, Raketensilos, Kommandozentralen…) geeignet – ganz im Gegenteil zu den landgestützten Systemen, an denen sich Deutschland nun interessiert zeigt.
In einem breit beachteten Handelsblatt-Beitrag machte voriges Jahr zum Beispiel Claudia Major, damals für die regierungsberatende „Stiftung Wissenschaft und Politik“ tätig, aus dem offensiven Charakter dieser Waffen überhaupt kein Hehl: „Die Tomahawks sollen bis zu 2.500 Kilometer weit fliegen können, könnten also Ziele in Russland treffen. Und ja, genau darum geht es. […] So hart es klingt. Im Ernstfall müssen NATO-Staaten auch selbst angreifen können, zum Beispiel, um russische Raketenfähigkeiten zu vernichten, bevor diese NATO-Gebiet angreifen können, und um russische Militärziele zu zerstören, wie Kommandozentralen.“
Als möglicher Flaschenhals bei der Beschaffung könnten sich die Produktionskapazitäten des Typhon-Herstellers Lockheed Martin erweisen. Diesbezüglich gab aber ein Beitrag bei defensenews.com Ende Juli 2025 Entwarnung (übersetzt mit deepl.com): „Lockheed Martin hat zugesagt, den Bau von Typhon-Raketenwerfern für Deutschland zu beschleunigen, sofern Berlin und Washington einen Kaufvertrag abschließen können. […] Dobeck, der Lockheed-Manager, sagte, das Unternehmen stehe mit den deutschen Unternehmen Diehl Defence und Rheinmetall in Kontakt, um eine lokale Partnerschaft für Typhon zu schließen.“
Andererseits könnten sich auch die Produktionskapazitäten von Tomahawk-Hersteller Raytheon als bremsend erweisen, wie der Stationierungsbefürworter Fabian Hoffmann bei hartpunkt.de warnte: „Die genaue jährliche Lieferkapazität für Tomahawk ist zwar nicht bekannt, dürfte aber bei der Mindestproduktionsrate von 90 Flugkörpern pro Jahr liegen. Es überrascht daher nicht, dass die Justification Books der US-Marine eine Gesamtvorlaufzeit von 2,5 bis 3 Jahren für neu bestellte Tomahawks angeben. Deutschland würde ebenfalls mit US-amerikanischen und ausländischen Kunden um Produktionskapazitäten konkurrieren und zunächst am Ende der Warteliste stehen (es sei denn, andere geben freiwillig ihre Kapazitäten ab). Selbst eine weitere bescheidene, eher homöopathische Bestellung im niedrigen dreistelligen Bereich könnte drei bis fünf Jahre dauern – oder sogar noch länger.“
Bleibt abschließend noch die Frage, ob die Kaufabsichten darauf hindeuten, dass die US-Regierung von der noch unter ihrem Vorgänger gefällten Entscheidung abrücken will, eigene Mittelstreckenwaffen in Deutschland zu stationieren. Hier läuft aktuell eine Überprüfung, deren Ergebnisse frühestens im September vorliegen sollen. Für den Kauf der Typhon-Systeme wäre zwar eine Zustimmung des Bundestages erforderlich, doch die dürfte sicher sein. Schließlich legt Deutschland augenscheinlich ein großes Interesse an den Tag, über diese Waffensysteme und die dazugehörigen Angriffsoptionen zu verfügen – wenn nicht über eine direkte US-Stationierung, dann über den Erwerb der Typhon-Systeme und perspektivisch durch die Entwicklung eigener Waffensysteme.
ELSA: Aufrüstung auf eigene Rechnung
Bereits die im Juni 2023 erschienene „Nationale Sicherheitsstrategie“ meldete einen dringenden Bedarf nach „abstandsfähigen Präzisionswaffen“ mit hoher Reichweite an. Unmittelbar ist man hier, wie beschrieben, auf US-Fähigkeiten angewiesen, ob über eine direkte US-Stationierung wie im Juli 2024 angekündigt oder als Alternative oder Ergänzung durch das nun angekündigte Interesse am Erwerb von Typhon-Systemen, ist aktuell noch offen.
Klar ist dagegen, dass die aktuelle Abhängigkeit von US-Kapazitäten in diesem Bereich nicht von Dauer sein soll. Um sie zu beenden, wurde die Entscheidung getroffen, eine eigene europäische – vermutlich landgestützte – Mittelstreckenwaffe mit einer Reichweite zwischen 1.000 und 2.000km zu entwickeln („European Long-Range Strike Approach“, ELSA). Eine dementsprechende Absichtserklärung wurde im Juli 2024 von den Verteidigungsministern Frankreichs, Polens, Italiens und Deutschlands unterzeichnet (später schlossen sich noch Großbritannien, Schweden und die Niederlande an). Mit ihrer Entwicklung dürfte MBDA beauftragt werden, das Gemeinschaftsunternehmen von Airbus (Deutschland/Frankreich), BAE Systems (Großbritannien) und Leonardo (Italien).
Zum Ziel des Vorhabens ließ das französische Verteidigungsministerium verlauten: „Die ELSA-Initiative zielt darauf ab, die Fähigkeit der Unterzeichnerstaaten zur Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Fähigkeiten in diesem Bereich in angemessener Zeit, zu angemessenen Kosten und in angemessenem Umfang zu verbessern. Dabei geht es sowohl darum, gemeinsam an der Erfüllung des militärischen Bedarfs an Langstreckenwaffen zu arbeiten als auch den Ausbau der europäischen Kapazitäten in diesem Bereich zu fördern. Dadurch wird die Fähigkeit der Europäer, auf das strategische Gleichgewicht Einfluss zu nehmen, gestärkt.“
Von sieben bis zehn Jahren Entwicklungszeit ist die Rede, zumindest für diesen Zeitraum will man direkt oder indirekt auf entsprechende US-Waffen zurückgreifen können. Dazu Verteidigungsminister Pistorius: „Wir brauchen eben eine Brückentechnologie und deswegen ist diese Übergangslösung für uns wichtig, gewissermaßen eine Brücke zu bauen zwischen der angekündigten – noch von der alten Administration angekündigten – temporären Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland bis zur Fertigstellung und bis zur fertigen Entwicklung der eigenen europäischen Systeme und dafür genau dient Typhon, dass ist der Plan, der dahintersteht.“
Doch auch wenn eigene Waffensysteme die der USA ablösen würden, wäre dadurch nichts gewonnen, da die dahinterstehende fatale Logik weiter am Werk wäre: „Wer die machtpolitische Bedeutung der Waffensysteme positiv bewertet und deren Einsatz aber selbst bestimmen will, setzt logischerweise auf eigene Entwicklungen – auch wenn hier mit Entwicklungszeiten von mehr als 10 Jahren und Kosten in mindestens zweistelliger Milliardenhöhe gerechnet wird“, so Claudia Haydt von der Informationsstelle Militarisierung (IMI). „Gleichzeitig ändert die europäische Hand am Abzug nichts an der konfrontativen Aufrüstungsdynamik. Je mehr einsatzbereite Waffen mit immer kürzerer Vorwarnzeit auf beiden Seiten vorhanden sind, umso mehr wächst das Risiko eines globalen Krieges und die Sicherheitslage verbessert sich somit nicht, sondern wird immer volatiler. Jeder Stationierungsort ist potentiell zugleich Ausgangspunkt und Ziel von Angriffen.“
Kampagnen gegen die Mittelstreckenwaffen
Russland hat auf diese Entwicklung bereits reagiert: Da sich die Zeitfenster für die Lagefeststellung möglicherweise bald radikal reduzieren, wurde mit Präsidentenerlass Nr. 991 im November 2024 die nukleare Einsatzschwelle gesenkt – kurz gesagt kann jetzt früher auf Verdacht zurückgeschossen werden. Und nahezu zeitgleich wurde erstmals eine russische Mittelstreckenwaffe („Oreschnik“) im Ukraine-Krieg eingesetzt. Da das gleichzeitige russische Angebot, zu einem Verbot landgestützter Mittelstreckenwaffen zurückzukehren, vom Westen unbeantwortet blieb, wurde inzwischen eine groß angelegte Produktion und Stationierung dieser und anderer Mittelstreckenwaffen angekündigt. So sollen bis Ende 2025 z.B. Oreschnik-Raketen in Belarus stationiert werden.
Wie uns das alles sicherer machen soll, bleibt das Geheimnis der Stationierungsbefürworter*innen. Gegen die geplante Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland formiert sich deshalb auch Widerstand. Am 3. Oktober 2024 wurde hierfür der Berliner Appell „Gegen neue Mittelstreckenwaffen und für eine friedliche Welt“ gestartet, der bislang von über 75.000 Menschen unterzeichnet wurde und in dem es unter anderem heißt: „Wir leben im gefährlichsten Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Gefahr, in einen atomaren Abgrund zu taumeln oder durch einen konventionellen Krieg umzukommen, ist real. An dieser Weggabelung stehen wir für eine friedliche und solidarische Welt der Gemeinsamen Sicherheit, Solidarität und Nachhaltigkeit für alle Menschen. Wir sagen Nein zur Aufstellung neuer US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland!“ (https://nie-wieder-krieg.org/)
Kurz darauf wurde im November 2024 die Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig. Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen“ ins Leben gerufen, in der sich mehr als 55 Organisationen und Gruppen engagieren. Die Kampagne fordert den Stopp der geplanten Stationierung von Mittelstreckenwaffen und will Proteste gegen diese Pläne unterstützen. Sie fordert zudem den Abbruch eigener Waffenentwicklungsprojekte in diese Richtung sowie ein Folgeabkommen zum INF-Vertrag und damit ein Verbot landgestützter Mittelstreckenwaffen auf allen Seiten. Auch den jüngst bekannt gewordenen Typhon-Ankaufsplänen steht die Kampagne extrem kritisch gegenüber. In einer Pressemitteilung wird ihr Sprecher Simon Bödecker mit den Worten zitiert: „Indem sie immer mehr auf Mittelstreckenwaffen setzt, leistet die Bundesregierung der Sicherheit Europas einen Bärendienst. Abschreckung bringt keine Sicherheit! Diese Waffen wirken destabilisierend und erhöhen die Eskalationsgefahr durch Fehleinschätzungen.“ (https://friedensfaehig.de/)
—————————-
Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen erweiterten und aktualisierten Artikel, der zuerst in der jungen Welt am 23. Juli 2025 erschien.
Quelle und weitere Infos: https://www.imi-online.de Bildbearbeitung: L.N.