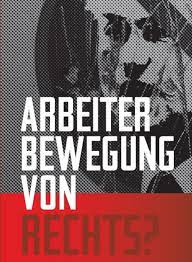Als die „Alternative für Deutschland“ (AfD) bei den Bundestagswahlen im September 2017 in das Parlament einzog, erhielt sie Wählerstimmen aus allen Bevölkerungsgruppen. Auffällig war jedoch, dass sie bei Arbeitern, Erwerbslosen und Gewerkschaftsmitgliedern auf überdurchschnittliche Resonanz stieß.
Mit 12,6 Prozent der Stimmen in den Bundestag eingezogen, votierten 19 Prozent der Arbeiter/innen und 15 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder (14 Prozent West, 22 Prozent Ost) für die populistische Formation. Die meisten AfD-Wähler/innen haben die mittlere Reife oder den Hauptschulabschluss, nur sieben Prozent der Akademiker/innen votieren für die AfD. Frauen sind in der Wählerschaft der Partei deutlich unterrepräsentiert; dafür sind die Anteile in ländlichen und strukturschwachen Regionen besonders hoch. Betrachtet man anstelle des von taktischen Kalkülen beeinflussten Wahlverhaltens die aussagekräftigeren Parteipräferenzen, ergibt sich ein ähnliches Bild.
Im Vergleich zu allen anderen Parteien weist die AfD die größte Einkommensspreizung, aber auch die höchsten Anteile an Arbeitern sowie abhängig Beschäftigten mit einfachen Arbeitstätigkeiten auf. Das Sozialprofil der ebenfalls rechtspopulistischen Pegida-Bewegung, die in Dresden zeitweilig Zehntausende auf die Straße brachte und Ableger in der gesamten Republik hat, wird ebenfalls von Arbeitern und Angestellten mit niedrigen bis mittleren Einkommen geprägt. In Selbstdarstellungen präsentiert sich die Bewegung als Bündnis von Mittelstand und Arbeiterklasse. Ähnlich agiert die AfD, wenn sie die „kleinen Leute“ als wichtige Zielgruppen ihrer Wahlkämpfe adressiert.
Mittlerweile geht die populistische Rechte noch einen Schritt weiter.
Bei den zurückliegenden Betriebsratswahlen versuchte sie – teils mit oppositionellen Listen, teils mit Infiltrierung von gewerkschaftlichen Listen – betriebliche Positionen zu erringen. Rechtsoppositionelle Listen wie das Zentrum Automobil geben sich im Betrieb globalisierungskritisch und kämpferisch und vermeiden rassistische Töne. Es kann aber kein Zweifel bestehen, dass Spitzenleute des Zentrums tief in der militanten Rechten verankert sind. Der Einfluss rechtsoppositioneller Betriebsräte ist bislang gering. Er beschränkt sich auf wenige Vorzeigewerke (u.a. Daimler Untertürkheim, Daimler Sindelfingen, Daimler Rastatt, BMW Leipzig, Porsche Leipzig) vor allem in der Automobilindustrie. Gefährlicher für die deutschen Gewerkschaften ist eine andere Entwicklung. Es gibt Betriebsräte, die sich im Unternehmen vorbildlich engagieren, bei politischen Fragen jedoch mit Pegida und der AfD sympathisieren.
Dass es ein rechtspopulistisches Potential unter Arbeitern und Gewerkschaftern gibt, ist lange bekannt. In der Forschung galt jedoch bisher als gesichert, dass radikal rechte Positionen unter aktiven Gewerkschafter(inne)n auf entschiedene Ablehnung stoßen und mit demokratischer Partizipation wirksam zu bekämpfen sind. Diese Gewissheit kann, so der irritierende Befund einer Studie, die wir 2017 u.a. in einer sächsischen Region durchgeführt haben, nicht mehr uneingeschränkt gelten. Aktive Gewerkschafter/innen, die in ihren Betrieben für steigende Organisationsgrade sorgen, sind teilweise bereit, eigenständig die Busse zu beschaffen, mit denen sie zu Pegida-Demonstrationen fahren. In der Selbstwahrnehmung handelt es sich um einander ergänzende Facetten demokratischen Aufbegehrens – mit der Gewerkschaft in Betrieb und Unternehmen, in der Gesellschaft mit Pegida und der AfD. Auf die Frage, ob Pegida eine Demokratiebewegung sei, antwortet ein sympathisierender Betriebsrat: „Ich denke schon“. Theoretisch könne die Bewegung „jeden ansprechen“; zwar schwebe „ein Nazi-Schatten“ über ihr, doch sie thematisiere, was eigentlich „jeden Normalen betrifft, der in Lohn und Brot steht“.
1. Rechtspopulistische Orientierungen bei Lohnabhängigen
Warum stößt der rechte Sozialpopulismus bei Arbeitern und Angestellten, auch bei gewerkschaftlich organisierten und aktiven, auf Sympathie? Mein Antwortversuch stützt sich auf eine qualitative Erhebung, die sich mit rechtspopulistischen Orientierungen bei Lohnabhängigen, Betriebsräten und Gewerkschaftern befasst, die wir in Ost und West, jedoch mit Schwerpunkt in einer ostdeutschen Region durchgeführt haben. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Arbeiter, zumal einfacher Produktionsarbeiter zu sein, bedeutet in der Selbstwahrnehmung von Befragten, in einer prosperierenden Gesellschaft festzustecken. Man erlebt den Rückgang der Arbeitslosigkeit und glaubt dennoch nicht daran, dass sich das eigene Leben grundlegend bessert. Stattdessen findet sich auch und gerade bei jüngeren Arbeiterinnen und Arbeitern wieder ein Gesellschaftsbild, das strikt zwischen oben und unten unterscheidet. Im Interview beschreibt eine junge, gewerkschaftlich aktive und ihrem Selbstverständnis nach linke Arbeiterin ihren schulischen und beruflichen Werdegang und ihre gegenwärtige Situation in einem sicheren Arbeitsverhältnis. Sie selbst ordnete sich der mittleren Mittelschicht zu, sieht aber ein großes Problem: „Diese Kluft zwischen der Mittelschicht […] und der Oberschicht ist einfach gigantisch. Ich werde es definitiv nie schaffen, über diese Kluft zu springen, nicht in meinem Leben, egal was ich mache. Und so ist es für viele, viele Menschen!“
An dieser Aussage ist zweierlei bemerkenswert. Arbeiterin zu sein bedeutet zum einen, mit einem festen Job und einem halbwegs guten Einkommen alles erreicht zu haben, was man erreichen kann. Mehr geht nicht. Arbeiter zu sein ist zum anderen aber kein Status, auf den man stolz sein könnte. Wie andere Befragte rechnet sich die junge Arbeiterin der „mittleren Mittelschicht“ zu. Das kann sie, weil sie weiß, dass es vielen schlechter geht als ihr selbst. Diese Grundhaltung ist für die von uns befragten Arbeiterinnen und Arbeiter – gleich ob links oder rechts, jung oder alt – typisch. Das eigentlich dichotomische, in einer Oben-Unten-Semantik transportierte, Weltbild wechselt im Vergleich zu den klassischen westdeutschen Arbeiterstudien aus der alten Bundesrepublik jedoch die Begrifflichkeit. Arbeiterin zu sein, zählt gesellschaftlich nur, weil damit der Zugang zur „mittleren Mittelschicht“ möglich wird. „Mittlere Mitte“ heißt auch: es geht nach oben nicht mehr viel, ein Absturz nach unten ist hingegen immer möglich. Denn – und das ist neu – in sozialer Nachbarschaft zum Arbeiterdasein lauern Ausgrenzung und Prekarität. Als Arbeiterin oder Arbeiter empfindet man sich möglicherweise als abgewertet, als ungerecht behandelt. Aber man ist dennoch nicht „ganz unten“, man hat noch immer etwas zu verlieren und man kennt andere, denen es, sei es berechtigt oder nicht, deutlich schlechter geht.
Dieses Grundbewusstsein, auf das wir unabhängig von der politischen Orientierung bei den meisten Befragten treffen, verbindet sich mit einer verborgenen, teilweise auch verdrängten Klassenproblematik. Man betrachtet sich weder als arm, noch als prekär beschäftigt. Dennoch bestimmt das Empfinden permanenter Benachteiligung das Bewusstsein. Nehmen wir das Beispiel einer Arbeiterfamilie im Osten Deutschlands. Mann und Frau arbeiten 40 Stunden Vollzeit für einen Brutto-Monatslohn von 1.600 bzw. 1.700 Euro. Nach Abzug aller Fixkosten verbleiben dem Haushalt mit zwei Kindern 1.000 Euro netto, von denen aber Kleidung, Nahrungsmittel usw. bezahlt werden müssen. Unter diesen Bedingungen wird jede größere Anschaffung, jede Reparatur am Auto zum Problem. Urlaub ist kaum möglich, und selbst für den Restaurant-Besuch am Wochenende reicht das Geld in der Regel nicht. Angesichts dieses Knappheitsregimes fühlen sich Arbeiterinnen und Arbeiter unverschuldet anormal. Und wenn festgestellt wird, dass rein statistisch „jeder Deutsche“ ein Durchschnittseinkommen von 3.300 € habe, dann verbindet sich bei Sympathisanten der extremen Rechten die Unzufriedenheit mit der eigenen ökonomischen Lage mit einer völkischen Komponente, ob man denn – bei geringem Einkommen – kein Deutscher sei.
Wichtig ist dabei eine semantische Verschiebung. Das Deutschsein wird zur Chiffre, die den Anspruch auf einen „normalen“ Lohn transportiert. Dieser Anspruch wird jedoch zugleich zu einem exklusiven, weil er eben eine Normalität nur der Deutschen einklagt. Befragte, die so argumentieren, fühlen sich nicht unbedingt abgehängt. Sie wollen „normal“ sein und unternehmen viel, um Normalität zu demonstrieren. Aber sie sind unzufrieden. Je geringer ihre Hoffnung ist, in den Verteilungskämpfen zwischen oben und unten erfolgreich zu sein, desto eher tendieren sie dazu, diesen Konflikt in einen zwischen leistungsbereiten Inländern einerseits und vermeintlich leistungsunwilligen ausländischen, kulturell nicht integrierbaren Eindringlingen andererseits zu interpretieren.
Auffällig ist, dass gewerkschaftliches Engagement für mehr Verteilungsgerechtigkeit und Plädoyers für Flüchtlingsabwehr und Ausgrenzung nicht als Widerspruch, sondern als unterschiedliche Achsen ein und desselben Verteilungskonflikts begriffen (oben versus unten, innen versus außen) werden. Dabei neigen auch aktive Gewerkschafter und Betriebsräte zu einer Radikalität, die in dieser Eindeutigkeit und Schärfe überrascht. So erklärt ein Betriebsrat, der gerade einen erfolgreichen Arbeitskampf initiierte hatte, im Interview unverhohlen: „Flüchtlinge sollten, zumindest ist das meine Meinung, sie sollten gehen müssen. Wer hierher kommt und arbeitet, sich integriert, sich einfügt, sich unterordnet, gut. Da habe ich kein Problem mit. Aber wer nur mit offener Hand hierher kommt und sich schlecht benimmt und meint, er kann machen, was er will, raus! … Ich hätte kein Problem damit, wenn sie Buchenwald wieder aufmachen, einen Stacheldrahtzaun drum herum ziehen und dann sind die da drin und wir hier draußen.“
In dieser Wahrnehmung erscheinen Fluchtmigranten als Sicherheitsrisiko. Der Diskurs über soziale Sicherheit verschiebt sich im Alltagsbewusstsein rechtsorientierter Arbeiterinnen und Arbeiter hin zu einer Debatte um die öffentliche und innere Sicherheit. Fluchtmigranten werden als potentielle Angehörige neuer gefährlicher Klassen betrachtet, kollektiv abgewertet und so zu einem Sicherheitsproblem erklärt. Plädoyers für „humane Konzentrationslager“ sind sicherlich eine extreme Ausnahme. Es handelt sich aber nicht um bloße Einzelfälle. Vielmehr sind sie radikalisierter Ausdruck einer in der Arbeiterschaft verbreiteten Stimmung, die bis tief in den gewerkschaftlich organisierten und aktiven Kern hineinreicht.
Wo sie sich regional als Sprecher einer schweigenden Mehrheit empfinden können – was noch immer die Ausnahme ist – treten rechtspopulistische Betriebsräte und Gewerkschafter auch in den Betrieben offensiv für ihre Positionen ein. Es gibt im Osten Deutschlands Belegschaften und Betriebsräte, in denen die Anhänger von PEGIDA und der AfD die Belegschaften majorisieren. Dabei kommt es zu sich selbst verstärkende Wechselwirkungen zwischen rechten Orientierungen, betrieblichen Erfahrungen und regionalem Umfeld. Rechtspopulistische Hegemonie in der Region stützt die Positionen rechter Interessenvertreter. In solchen Fällen ist die Nähe zu offen nazistischen, rechtsextremen und gewaltaffinen Positionen für die betrieblichen und gewerkschaftlichen Repräsentanten der neuen Rechten und ihre Unterstützer in den Belegschaften offenbar kein Tabu. Typisch für rechtspopulistische Alltagsphilosophien ist nicht mehr die Abwertung, sondern die offensive Vereinnahmung von Demokratie. Alle befragten Betriebsräte mit Affinität zum Rechtspopulismus plädieren für mehr direkte Demokratie, weil sie überzeugt sind, auf diese Weise ihre Positionen besser durchsetzen zu können.
2. Verdrängte Klassenerfahrung und Gewaltbereitschaft
Rechtspopulistische Alltagsphilosophien korrespondieren mit Ungerechtigkeitserfahrungen, sie sind jedoch – zumindest in den Betrieben und unter festangestellten Arbeiterinnen und Arbeitern – kein Ausdruck von Verelendung, immer weiter fortschreitender Prekarisierung oder extremer Armut. Es muss eben nicht alles immer schlechter werden, um die Wahrnehmung einer ungerechten Gesellschaft hervorzubringen. Gerade der Rückgang der Arbeitslosigkeit kann dazu führen, dass diejenigen, die hinter der medial vermittelten Welt des Jobwunder-Landes zurückbleiben, nun beginnen, ihre Ansprüche an gute Arbeit und ein gutes Leben selbstbewusster, teilweise aber auch mit Verbitterung vorzutragen. Ein Gewerkschaftssekretär gab dazu folgende Erklärungen: „Es ist nicht nur die Angst, es ist eine Mischung aus vielen Faktoren, die die Lohnabhängigen unzufrieden machen. Man hat vielleicht einen festen Arbeitsvertrag und verdient trotzdem nicht genug, um sich den Lebensstil zu leisten, den die Medien als Standard darstellen. Viele fühlen sich von einer Wohlstandsgesellschaft umgeben, mit der sie nicht mithalten können, mit der sie den Anschluss verlieren. Aber es gibt kein öffentliches Bewusstsein für diese Probleme. Die Arbeiter sind in der Öffentlichkeit einfach nicht mehr sichtbar. Und dann tauchen die Flüchtlinge auf und bekommen ein Maß an Aufmerksamkeit, das man nicht hat. Viele empfinden das als ungerecht. Und deshalb ist es auch kein Widerspruch, wenn Betriebsräte und aktive Gewerkschafter sich aktiv am Arbeitskampf beteiligen und gleichzeitig an PEGIDA-Aufmärschen teilnehmen.“
Es ist der Abstand zu einer fiktiven, einer inszenierten gesellschaftlichen Realität, die Frustration und Wut erzeugt und inzwischen auch zum Aufbegehren provoziert. Nicht allein die Angst vor Statusverlust, sondern die Unzufriedenheit damit, dass man einen Status, den man selbst als angemessen betrachtet und der der eigenen Leistungen entspricht, nicht erreichen kann, provoziert Verdruss. Man empfindet sich als unverschuldet anormal, als abgewertet und genau das erzeugt Unzufriedenheit und Wut. Diese Beobachtung gilt sicherlich nicht ausschließlich, nach Ansicht befragter Experten aber doch in besonderem Maße für – männliche – Fach- und Produktionsarbeiter in Industriebetrieben. Es handelt sich weniger um eine Prekaritäts- als um eine – verdrängte und politisch in problematischer Weise verarbeitet – Klassenerfahrung.
Diese Verdrängung erzeugt, das ist ein besonders beklemmendes Resultat unserer Forschungen, offenkundig Gewaltbereitschaft oder doch zumindest klammheimliche Sympathie für fremdenfeindliche Gewalt. Weil Gerechtigkeitsmaßstäbe wegen einer Bevorzugung Geflüchteter außer Kraft gesetzt seien und eine „Umvolkung“ durch Zuwanderung erfolge, rechtfertige das, so die Sicht radikal rechter Arbeiter, Gegenmaßnahmen. Bezeichnend ist, dass alle Befragten, die mit Pegida, der AfD oder extremen Rechtsparteien sympathisieren, eine erstaunliche Gewaltaffinität aufweisen. Keiner der rechtsaffinen Arbeiter will sich eindeutig und ohne jede Relativierung von Gewalttaten gegen Flüchtlinge oder deren Unterkünfte distanzieren.
3. Rechtspopulismus – eine Herausforderung für die Gewerkschaften
Unsere Untersuchung belegt die Entstehung einer ernst zu nehmenden national-sozialen Gefahr. Tatsächlich existiert in Deutschland der „Saatboden für einen neuen Faschismus“ (Jürgen Habermas). Die völkische Rechte setzt – freilich von inneren Kämpfen begleitet –mehr und mehr auf einen Sozialpopulismus, der es ihr erlaubt, soziale Verwerfungen erfolgreich als Mobilisierungsressource zu nutzen. In unterschiedlichen Ausprägungen findet die von ihr betriebene Ethnisierung des Sozialen Anhänger auch unter gewerkschaftlich Aktiven und Betriebsräten. Sprachduktus und Begriffswahl der Befragten bewegen sich auf dem Niveau von „Urteilen zweiten Grades“ (Pierre Bourdieu), d. h. sie folgen bereits der Linie einer Partei. Wer derart hermetisch argumentiert, lässt sich kurzfristig kaum von seinen Überzeugungen abbringen. Für jede kritische Nachfrage haben rechtspopulistische Gewerkschafter passende Antworten parat. Eigene Überzeugungen werden proaktiv gegen jedwede Kritik immunisiert. Gemeinsam mit der Gewaltaffinität deutet das auf eine Verfestigung und Radikalisierung rechter Orientierungen hin.
Wir sprechen von einer national-sozialen Gefahr, weil das zusätzlich zur Betonung der sozialpopulistischen Dimension die Offenheit für traditionelle NS-Ideologeme kenntlich machen soll. Mit der Bezeichnung völkisch-populistisch verbinden wir eine ähnliche Intention. Vorstellungen vom Volk als homogener Gemeinschaft sind der ideologische Kitt, der radikal rechte Weltbilder zusammenhält. Beide Zuschreibungen signalisieren, dass Arbeit am Begriff notwendig ist. Wenn die Befürwortung von Gewalt als Kriterium wegfällt, um Rechtspopulismus und -extremismus voneinander zu unterscheiden und die Abgrenzung von traditionsfaschistischen Positionen für die neue Rechte bis zu einem gewissen Grade obsolet wird, muss das zu bezeichnende Phänomen neu benannt werden.
Unabhängig davon besteht kein Zweifel, dass das betriebliche und gewerkschaftliche Engagement radikal rechter Arbeiter auch von legitimen sozialen Protestmotiven getrieben wird. Dennoch handelt es sich bei den Formationen, mit denen diese Arbeiter sympathisieren, nicht um Repräsentationen einer neuen Arbeiterbewegung. Arbeiterbewegungen des Marx´schen Typus sind Ausdruck eines Klassenhandelns, das auf eine Verbesserung kollektiver Positionen im sozialen Raum zielt. Solche Klassenbewegungen brechen am Kausalmechanismus Ausbeutung oder schwächer: an ungerechten Verteilungsverhältnissen auf und richten sich gegen die aneignenden Klassen. Bewegungen Polanyi´schen Typs klagen hingegen primär Schutz vor marktgetriebener Konkurrenz ein. Sie attackieren eine diffuse Marktmacht, die unter Lohnabhängigen eine Tendenz bestärken kann, klassenunspezifische Grenzen abzustecken, um vor dem Mahlstrom des Marktes geschützt zu werden. Pegida und die AfD stehen für solche Bewegungen Polanyi´schen Typs. Anstelle von Ausbeutung agiert diese Bewegung mit Kausalmechanismen wie „Umvolkung“ oder „Einwanderung in die Sozialsysteme“. Die Motive, die zur populistischen Revolte führen, lassen sich indes nicht säuberlich in sozioökonomische und kulturelle aufspalten. Radikal rechte Arbeiter verteidigen ihren Lebensstil. Doch die verinnerlichten Dispositionen und Geschmacksurteile, die diesen Lebensstil hervorbringen, wurzeln in sozioökonomischen (Klassen-)Verhältnissen. Grundlegend für die Weltsicht der Befragten ist das Empfinden, am gesellschaftlichen Wohlstand nicht angemessen beteiligt zu sein – materiell wie kulturell. Deshalb haben sich Befragte gewerkschaftlich organisiert und in Betriebsräte wählen lassen. Ihren Sozialprotest stark zu relativieren oder gar in Frage zu stellen, liefe deshalb darauf hinaus, empirische Fakten zu ignorieren.
Bei seinen Versuchen zur Nationalisierung und Ethnisierung der sozialen Frage kann der völkische Populismus an eine spontane Tendenz zu exklusiver Solidarität anknüpfen, wie sie in der Industriearbeiterschaft und hier vor allem in Stammbelegschaften und unter Festangestellten verbreitet ist. Exklusive Solidarität grenzt sich nicht nur gegen oben, sondern auch gegen fremd, leistungsunwillig und anders ab. Völkischer Populismus, der mit der Imagination eines ethnisch-kulturell homogenen „Volkskörpers“ operiert, verstärkt solche Tendenzen und ist deshalb für jedwede gewerkschaftliche (Klassen-)Solidarität ein Sprengsatz. Gerade deshalb fällt den Gewerkschaften in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der national-sozialen Gefahr eine Schlüsselrolle zu. Häufig sind Gewerkschaften die einzigen demokratischen Organisationen, die Arbeiter mit Sympathien für die völkische Rechte überhaupt noch erreichen.
Längerfristig muss es ein Hauptanliegen von Gewerkschaften sein, jene Kausalmechanismen zu verändern, mit deren Hilfe sich das Alltagsbewusstsein Lohnabhängiger Ungleichheit und Unsicherheit erklärt. Lange Zeit war, wie der französische Soziologe Didier Eribon schreibt, „nicht mehr von Ausbeutung und Widerstand“ die Rede, „sondern von ‚notwendigen Reformen‘ und einer ‚Umgestaltung‘ der Gesellschaft. Nicht mehr von Klassenverhältnissen und sozialem Schicksal, sondern von ‚Zusammenleben‘ und ‚Eigenverantwortung‘. Die Idee der Unterdrückung, einer strukturierenden Polarität zwischen Herrschenden und Beherrschten, verschwand aus dem Diskurs der offiziellen Linken und wurde durch die neutralisierende Vorstellung des ‚Gesellschaftsvertrages‘ ersetzt.“ (Diedier Eribon, Rückkehr nach Reims , Berlin 2016, S. 120.
Das muss sich ändern. Wenn sie dem Vorwurf der Neuen Rechten, Gewerkschaften gehörten zum Establishment, entkräften wollen, müssen die Arbeitnehmerorganisationen wieder stärker zu sozialen Bewegungen werden. Sie hätten Klassen- und Ausbeutungsverhältnisse wieder öffentlich zu thematisieren und zugleich eine kollektive Diskussion darüber zu ermöglichen, „welche Themen überhaupt legitim und wichtig sind und daher in Angriff genommen werden sollten“ (Eribon 2016: 146). Von einem intakten Resonanzraum, der dies leisten könnte, sind wir gegenwärtig aber meilenweit entfernt. Anders als während der 1980er Jahre lösten selbst Streiks der IG Metall für Arbeitszeitverkürzung mit 1,5 Mio. Beteiligten, die den Einstieg in eine verkürzte Vollzeit von 28 Stunden und mehr individuelle Zeit für Pflege, Erziehung und Erholung von Schichtarbeit durchgesetzt haben, in der gesamten akademischen Linken nur ein schwaches Echo aus. Diesbezüglich kann besonders die akademische Linke von befragten Arbeitern und Gewerkschafter(inne)n lernen, die ihre Ablehnung von AfD und Pegida öffentlich machen. Diese Befragten plädieren einhellig für eine – inklusive, demokratische – Klassenpolitik, die gemeinsame Interessen „sagen wir: selbst chinesischer und deutscher Arbeiter“ gegen das dominante Kapital betont. Gewerkschafter, die sich so positionieren, bilden unter den Aktiven noch immer die Mehrheit. Jede gewerkschaftliche Anpassung an die rechtspopulistische Revolte liefe hingegen darauf hinaus, die Unterstützung dieser Aktiven aufs Spiel zu setzen. Kein Befragter, die den Reichtum der Reichen als zentrale Ursache für die Armut der Armen betrachtet (Erik Olin Wright), käme indes auf die Idee, inklusive Klassenpolitik werte Konflikte ab, die an den Achsen Geschlecht, Ethnie/Nationalität oder an Naturverhältnissen aufbrechen. Klassenpolitik und gewerkschaftliche Solidarität sind ihrer inneren Logik nach universalistisch. Um Wirkung zu erzielen, müssen sie über Geschlechtergrenzen, Nationalität und ethische Spaltungen hinweg verbinden. Deshalb sind sie mit völkischen Integrationskonzepten unvereinbar.
In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass die betriebliche Arbeitswelt durchaus Erfahrungsräume bietet, in denen Klassenerfahrung in Widerspruch zu völkischem Gedankengut tritt. Daran knüpfen gewerkschaftliche Praktiker an. Sie können sich darauf berufen, dass Bewegungen gegen sexistische und rassistische Diskriminierung ihre größten Erfolge immer dann erzielt haben, wenn auch der „demokratische Klassenkampf“ (Walter Korpi) zugunsten der Lohnabhängigen einigermaßen erfolgreich war. Die 1968-Revolte entdeckte den Klassenkampf – wohl in überhöhter Weise – neu. Zugleich war sie auch eine kulturelle Rebellion für sexuelle Befreiung, Frauenemanzipation, Bürgerrechte und in ihrer Spätwirkung zudem Katalysator für Bewegungen zugunsten ökologischer Nachhaltigkeit. In der Auseinandersetzung mit dem völkischen Populismus wird eine solche Bewegung wieder gebraucht – in den Betrieben, national und global.
Grundlagenliteratur: Karina Becker (Hg.), Klaus Dörre (Hg.), Peter Reif-Spirek (Hg.), Arbeiterbewegung von rechts? Ungleichheit – Verteilungskämpfe – populistische Revolte, 359 Seiten, Campus-Verlag ISBN 9783593509716
Der Beitrag erschien in Marxistische Blätter https://www.neue-impulse-verlag.de/ und wird hier mit freundlicher Genehmigung der Redaktion gespiegelt. Bild: mach meinen kumpel nicht an https://www.gelbehand.de/